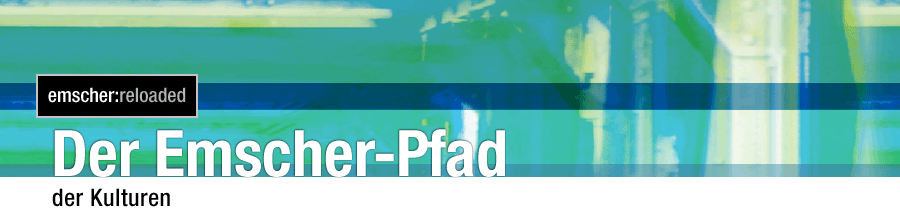
Kultur-Orte entlang der Emscher werden geschaffen
zur Bündelung der unterschiedlichen sozialen
und kulturellen Energien
Idee und Konzept: Dr. Arnold Voss
Bearbeitung: K.-H. Blomann, Prof. Dr. K. Liebsch, R. Schumacher, Dr. A. Voss
Vorbemerkung:
In den nächsten zwei Jahrzehnten erfolgt in dem Projekt „Emscher-Umbau“ die (Rück-)Verwandlung eines der größten Abwassersysteme der Welt in eine Flusslandschaft. Der Lauf der Emscher soll im Zuge dessen zu einem integrierten und attraktiven Bestandteil der umliegenden Städte und Landschaften werden. Angestrebt ist, durch die umfassende naturräumliche und technische Umgestaltung der Emscher die Lebensbedingungen im Emschertal so zu verbessern, dass Anwohnerinnen und Anwohner der Region verhaftet bleiben und sie wertschätzen.
Dass der bevorstehende Wandel in der Emscherzone nicht allein ein räumlich-technisches Projekt darstellt, sondern auch sozial und kulturell gestaltet werden muss, ist die Grundüberzeugung der hier vorgestellten Projektidee Emscher-Pfad der Kulturen.
Der Emscher-Pfad der Kulturen zielt darauf ab, in Zusammenarbeit mit regionalen Einrichtungen, ortsansässigen, ortskundigen und interessierten Personen Möglichkeiten zu schaffen, die Region wie auch die bevorstehenden und die bereits realisierten Veränderungen kulturell-ästhetisch zu thematisieren. Dafür sollen entlang der Emscher Kultur-Orte geschaffen werden, an denen die regionale Bevölkerung aktiv werden, sich ausdrücken und ihre Sicht auf die Region zum Thema machen kann.
Drei kulturelle und soziale Besonderheiten der Region sollen beim Emscher-Pfad der Kulturen sichtbar und erlebbar gemacht werden:
- Das Ende des Industriezeitalters
- Der hohe Anteil von Migrantinnen und Migranten in der lokalen Bevölkerung
- Die Geschichte und die Zukunft der Zu- und Abwanderung
Absicht ist es, entlang der Emscher verschiedene „Stationen“ zu schaffen, an denen die kulturelle Seite des räumlichen und technischen Wandels in der Emscherzone thematisiert wird. Die „Stationen“ werden in Form von größeren und kleinen Gärten gestaltet und sind zugleich auch Orte künstlerischer Intervention und kultureller Praxis entlang der Emscher. Die „Stationen“ stellen Raum für Installationen, Performances, Objekte, Konzerte und Diskussionsveranstaltungen zur Verfügung. Zudem bieten sie verschiedenen Bevölkerungsgruppen Gelegenheit, ihre Vorstellungen und Traditionen von Landschafts- und Gartenkunst darzustellen.
Dabei macht das Vorhaben Emscher-Pfad der Kulturen seinen gesellschafts- und kulturpolitischen Kontext immer mit zum Thema: Globalisierung und Europäisierung, Fragen nach der Rolle von Kultur und Kunst im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung wie auch Fragen zur Teilhabe und Mitbestimmung durch die Bevölkerung sind thematische und gestalterische Bestandteile der Realisierung einer jeden geplanten „Station“ entlang des Emscher-Pfads der Kulturen.
In dem vorliegenden Konzeptpapier werden zunächst übergreifende Leitlinien zur Ausgestaltung des Emscher-Pfads der Kulturen skizziert und anschließend Realisierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Projektidee beschrieben.
- Einwanderung und Interkulturalität
- Natur- und Kulturverhältnisse
- Transnationalität und Partizipation
1. Einwanderung und Interkulturalität
Die Migration, ihre Probleme und ihre Chancen sind für ganz Europa ein wichtiges Thema.(1) Auch entlang der Emscher haben sich auf einer Strecke von gut achtzig Kilometern durch einen der größten Ballungsräume Europas in den letzten vierzig Jahren viele Menschen verschiedener Herkunft niedergelassen. Die Region war lange Zeit von Zuwanderung bestimmt, muss sich heute aber, nach dem Rückzug von Stahlindustrie und Bergbau, im Rahmen einer allgemeinen Konkurrenz der Standorte als Lebensraum, als Wirtschaftsraum und als Kulturraum neu behaupten.(2) Dadurch wird die Frage aufgeworfen, welche Qualität eine Region bieten muss, um einer Abwanderung von Einwohnern entgegen zu wirken. Welche Bildungs-, Freizeit- und Tourismusangebote werden als attraktiv angesehen und wie werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Region eingeschätzt?
Die gegenwärtige regionale Kultur und Geschichte der Emscherregion ist eine Geschichte der Migration und eine Kultur der Vielheit. Geschichte und Kultur thematisieren das Hin- und Herpendeln zwischen Weggehen und Ankommen, transportieren Spuren des oft unfreiwilligen Verlassens der alten Heimat, des mentalen und sozialen Festhaltens an Traditionen, die vom Ort der Herkunft her bestimmt sind, zeigen aber auch die Aneignung der Strukturen des neuen Aufenthaltsorts. In der Vergangenheit und der Gegenwart der Region hat sich das Ankommen auf vielerlei Weise realisiert und sich in unterschiedlichen Formen des Einlassens und der Verwurzelung gezeigt.
Erst aber mit einer Bleibeperspektive wird auch die Zukunft als Zeithorizont sichtbar. Perspektiven des Bleibens sind zudem davon abhängig, wie stark die ökonomische und soziale Lage als attraktiv und sicher angesehen wird. Das „Zukunftsprojekt Emscher-Umbau“ könnte dem subjektiven Bleibenwollen eine objektive Basis geben, eine neue Integrationsperspektive eröffnen, wenn es gelänge ein Denken zu stärken, welches den Umbau der Emscher als ein gemeinsames Projekt für eine gemeinsame Zukunft begreift.
Die Verklammerung des Bleiben-Wollens mit der Zukunftsperspektive bietet den Rahmen für einen ernst gemeinten und sachbezogenen interkulturellen Dialog. Die konkrete Frage hieße dabei: Was bedeutet der Emscher-Umbau für uns gemeinsam?
Zu den regionalen Charakteristika, die der Emscher-Pfad der Kulturen künstlerisch zu bearbeiten sucht, gehört deshalb zentral, dass das Emschertal seit seiner industriellen Besiedlung eine Vielzahl unterschiedlicher ethnischer und religiöser Bevölkerungsgruppen aufgenommen hat. Als Effekt von Globalisierung und Transnationalität bringt Migration ihrerseits die Vervielfältigung der Kulturen und kultureller Ausdrucksformen und Facetten in der Einwanderungsregion mit sich.(3) Eine am Emscherraum orientierte Kunst sollte deshalb Inter- und Multikulturalität berücksichtigen und den Dialog der Kulturen stärken.
�2. Natur- und Kulturverhältnisse
Der Prozess einer Re-Naturierung des gesamten Emscherlaufs ist ein Vorgang der Kulturalisierung, der das Ende des Industriezeitalters in der Region sichtbar macht. Dabei entsteht ein anderer Sozial-Raum, in dem Natur, Kultur und Menschen in ein neues Verhältnis gesetzt werden. Wie sich dies konkret entwickeln und wie das neue Emschertal von Besuchern und der Bevölkerung erfahren und erlebt werden wird, ist heute nur erahnbar. Vermutet werden kann, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was in Randlagen und Zwischenzonen des Emscher-Umbaus gedeihen wird, sowohl städtisch als auch ländlich als auch vorstädtisch ist. Einige mögen die Re-Naturierung des Flusslaufs für eine neue Wildnis halten, für andere mag genau die Kombination von ursprünglichem Flusslauf und angrenzenden urbanen Siedlungen als die Zukunft des Städtischen gelten. Auf jeden Fall wird der neue Emscherraum Anlass dazu bieten, die Wahrnehmung des Raums und die Parameter zu seiner Erfassung – Peripherie/Zentrum, Mensch/Umwelt, privat/öffentlich, lokal/global – neu zu formulieren. Der im Prozess des Emscher-Umbaus sich entwickelnde neue Raum macht Natur zugänglich, ohne das Kulturelle und Urbane auszugrenzen. Die Gegensätze von Wachstum und Schrumpfung, Ökologie und Ästhetik werden an der räumlichen Achse Stadtrand dezentriert und als eine neue Regionalentwicklungspolitik sichtbar. Es geht um ein „Da-Zwischen“, an dem die Peripherie überall – an vielen topographischen Orten – ist.(4) Das „Da-Zwischen“ zeigt Gegebenheiten der postindustriellen Stadtrand-Verhältnisse und ist gekennzeichnet von der Überlagerung von Räumen unterschiedlicher Prägung mit den charakteristischen Einsprengseln nahezu jedweder Nutzungsart und baulicher Form. Dies macht es erforderlich, die sozialräumliche Komplexität von Stadtrandarealen und Brachflächen neu zu entziffern.
Das neue Verhältnis zwischen Natur und Kultur im Emscher-Raum soll an den „Stationen“ des Emscher-Pfads der Kulturen auf vielfältige Weise künstlerisch und gartenarchitektonisch bearbeitet und dargestellt werden: Malerei, Fotografie, Klang, Musik und Texte sowie Variationen von Arten und Formen der Bepflanzungen und diverse Weg- und Nutzungsoptionen bieten eine breite Palette, die Wechselbeziehungen von Natürlichkeit und Kulturellem zu thematisieren.
Der Prozess des Emscher-Umbaus steht unter dem Vorzeichen von ökologischem Umbau und Nachhaltigkeit, zwei Ausrichtungen, die im Rahmen der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen und der dort verabschiedeten „Agenda 21“(5) als Leitlinien für die Entwicklung des 21. Jahrhunderts festgeschrieben wurden. Dabei ist die prozessorientierte, intervenierende Projektkunst wichtig, weil sie, zumindest theoretisch, diverse Beteiligungs- und Demokratisierungsangebote enthält.(6)
Eine Ästhetik der Nachhaltigkeit ist immer auch eine Ästhetik der Teilhabe.(7)
3. Transnationalität und Partizipation
Der Emscher-Pfad der Kulturen greift den künstlerischen Diskurs der Aneignung der Städte durch die dort lebende Bevölkerung auf: den Urbanismus. Das Thema ist als „New Public Art“ auf Biennalen und internationalen Ausstellungen zunehmend gegenwärtig und hat sich zu einem eigenen, lebendigen Strang der Kunst entwickelt. Überall auf der Welt werden mit dem Ende des industriellen Zeitalters neue urbane Aktivitäten entwickelt, die künstlerische Eingriffs- und Handlungsmöglichkeiten im städtischen Raum entwerfen und ausprobieren. Anhand von Interviews, Lageberichten, Planmaterial und Fotos der vor Ort agierenden Projekte wird eine andere Praxis von Stadt und stadtgesellschaftlicher Bewegung sichtbar.(8) Teilhabe und Einbeziehung der Bevölkerung ist bei dieser Art der Thematisierung des lokalen Lebensraums unerlässlich.
Dabei muss Berücksichtigung finden, dass das den Emscher-Raum und den bevorstehenden Emscher-Umbau prägende Thema die Interkulturalität, Mischkulturalität und Vielsprachigkeit der Region ist. Das Thema zeigt sich in der regionalen Alltagskultur, in Planungs- und Wissenskonzepten und kommt in künstlerischer Praxis wie auch Regierungspolitiken zum Einsatz und kann als „transnational“ charakterisiert werden.
Transnationalität konstituiert sich vielsprachig und mit der Ausbildung von Mehrfachidentitäten. Die Produktivität des transnationalen Miteinanders muss durch eine entsprechende Kulturpolitik gestützt werden. Transnationalität stabilisiert sich im Rahmen einer Zivilgesellschaft, in der sich verschiedene Gruppen und Gemeinschaften in neuer Art und Weise zueinander verhalten, in der Fremde und Einheimische, Junge und Alte Menschen verschiedener Kulturen, mit unterschiedlichen Vorlieben und Geschmäckern Gelegenheit haben, sich aufeinander zu beziehen.(9) Wichtigstes Element einer transnationalen Kulturpolitik, die sich um Gemeinsames bemüht, muss daher Demokratie im Sinne eines Interessensausgleichs sein.
Da die „Stationen“ entlang des Emscher-Pfads der Kulturen zum einen als Treffpunkt für Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen fungieren sollen und zum zweiten als künstlerisch geprägte Orte selbst schon ein gewisses Streitpotenzial enthalten, ist zu erwarten, dass sich hier unterschiedliche Formen von Kulturkontakt und Kulturkonflikt ergeben. Die „Stationen“ des Pfads der Kulturen bringen die Bedingungen für das Gelingen und Misslingen des interkulturellen Dialogs in das öffentliche Bewusstsein, indem sie regionale Voraussetzungen – die besondere Örtlichkeit – sichtbar machen. Es ist ein wesentlicher Teil des Konzepts für einen Pfad der Kulturen, ein spezielles Ortsbewusstsein systematisch zu erzeugen und zu befördern.
Deshalb ist die Organisation des Partizipationsprozesses eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Realisation des Emscher-Pfads der Kulturen. Zum einen gilt es, lokale Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden. Diese können im Rückgriff auf ihre jeweiligen Netzwerke besondere Vorschläge für die inhaltliche wie auch die prozessurale Vorgehensweise erarbeiten, die ihrerseits wiederum in beteiligten Gemeinden und ihren Institutionen öffentlich gemacht und zur Debatte gestellt werden.(10) Diese Arbeitsbündnisse bilden das zentrale Verbindungsglied zwischen den gestaltenden Künstlern/ Architekten und der regionalen bzw. lokalen Community.
4. DAS KONZEPT
Der Emscher-Pfad der Kulturen und seine „Stationen“
- Zeit und Umfang
- Orte und Flächen
- Themen und Inhalte
- Partizipation und Mitarbeit
- Experten und Unterstützer
- Konkretisierungen und Konzeptualisierungen
Der Emscher-Pfad der Kulturen versteht sich als eine explorierende und im Ergebnis offene Form der Thematisierung von Trans- und Multikulturalität. Sowohl virtuell als auch materiell-konkret soll beim Emscher-Pfad der Kulturen die künstlerische Aufmerksamkeit explizit auf die sozialen und gesellschaftlichen Aspekte ausgewählter Orte des Emscherlaufs gelegt werden. Sozialpolitische, historische, wirtschaftliche, ökologische Strukturen sollen analytisch und experimentell untersucht und sprachlich und ästhetisch neu, verfremdet, anders dargestellt werden. In enger Kooperation zwischen den für das Projekt engagierten Künstlern, Architekten bzw. Planungsbüros und den regionalen Partnern – z.B. Schulen, Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit, Behörden, Parteien, Vereinen wie auch interessierten Familien und Einzelpersonen – werden zunächst Konzepte entwickelt und nachfolgend die künstlerische Ausgestaltung geplant und diskutiert.
Gemäß dem Bild des „Pfads“ sollen die „Stationen“ des Emscher-Pfads der Kulturen Verweil- und Aufenthaltsqualitäten bieten – für Touristen wie auch für die einheimische Bevölkerung, die diese Orte als ihre Treffpunkte annehmen und sie in ihren unmittelbaren Lebensraum integriert. Da der Emscher-Pfad der Kulturen durch eine dicht besiedelte Stadtlandschaft verläuft, hat er nicht nur eine kulturelle und künstlerische Funktion, sondern spielt auch eine Rolle als Fuß- und Radwegeroute für seine Anwohner. Seine „Stationen“ sind von daher nicht nur Verweil-Orte für die Besucher der Stationen, sondern auch Durchgangsorte für den nicht motorisierten Regionalverkehr. Die „Stationen“ sind damit zugleich auch Orte der regionalen Freizeit, der alltäglichen kleinen Fluchten und der zufälligen Begegnung. Die Gestaltung der „Stationen“ soll diese Nähe zu den alltäglichen Bedürfnissen der Menschen aufnehmen.
Der Emscher-Pfad der Kulturen ist „Kunst im öffentlichen Raum“ im klassischen Sinne, sprich ein prinzipiell jeder Person ohne Auflagen und Eintritt zugänglicher Ort der Kunst.
Thematisch bietet es sich bei der Ausgestaltung der „Stationen“ an, Örtlichkeit und Zeitlichkeit zu bearbeiten. Der Sache entsprechend beginnen beide Themen mit der Geschichte des Emscher-Umbaus. Der landschaftsgestalterische und technische Umbau des Flusses vollzieht sich in kleinen Schritten auf der Ost-West-Achse entlang des Flusses und mobilisiert in jeder Planungsphase und ihrer Realisierung Erinnerungen an Geschichte und die mit diesen Orten verknüpften Erfahrungen. Eine Spur von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft soll an den „Stationen“ des Pfads der Kulturen gestalterisch und räumlich konkretisiert werden.
Bei der formalen Ausgestaltung der „Stationen“ soll die Idee des interkulturellen Gartens leitend sein. Die interkulturellen Gärten bieten einen landschafts- und stadträumlichen Rahmen für Aufenthalte, Durchgänge, Dialoge und Begegnungen aller Besucherinnen und Besucher. In ihren räumlichen und gestalterischen Zugängen können sie beispielsweise ausgewählte Traditionen von Einwanderergruppen aufnehmen oder auch verschiedene Nutzungsansprüche realisieren. Ziel einer „kollektiven Wunschproduktion“(11) zur Gestaltung des Raumes wäre es, Aktionen durchzuführen, die dafür sorgen, dass diese Orte als Treffpunkte angenommen, in den Lebensraum integriert werden und dass sich mit ihnen identifiziert wird.
Das Gartenkonzept
Die „Stationen“ gestalten sich als Gärten, die Interkulturalität und Transnationalität thematisieren. Als Ausdruck kultureller Besonderheit wie auch Vielfalt auf Basis des ethnischen Einwanderungshintergrundes bietet jeder einzelne interkulturelle Garten eine Gelegenheit, Elementen verschiedener Kulturen zum Ausdruck zu verhelfen, so dass die Gärten auch einen Teil der Geschichte und Zukunftswünsche der Gestaltenden widerspiegeln. Dabei wird entscheidend sein, welche Idee von Garten die Beteiligten aus ihrer jeweiligen Kultur mitbringen. Dies kann Vorstellungen von hochherrschaftlichen Räumen zum Flanieren genauso umfassen wie die Möglichkeit, kleine Beete für den Gemüseanbau anzulegen oder einen Ort zum Spielen und Zusammen-Sein zu gestalten.
Die einzelnen interkulturellen Gärten sollen als besondere Räume in der sie umgebenden Stadtlandschaft/Emscherlandschaft deutlich wahrnehmbar sein. Als „Stationen“ entlang des Emscherwegs und aufgrund ihrer dialogischen Qualität sind ihre Begrenzungen zwar gut sichtbar, zugleich aber auch durchlässig.
Der Emscher-Pfad der Kulturen mit seinen interkulturellen Gärten schließt in mehrfacher Weise an baukulturelle Entwicklungen des Ruhrgebiets an:
- An das Konzept der Gartenstadt, das zumindest im Bereich des Arbeitersiedlungsbaus im Ruhrgebiet Tradition hat und bei der IBA-Emscherpark erneut thematisiert und aktualisiert wurde.(12)
- An das Konzept der Landmarken und der Land-Art, das ebenfalls im Rahmen der IBA-Emscherpark im Emschertal Wegzeichen und Begegnungsorte hergestellt hat.
- An die landschaftsarchitektonische und baugestalterische Wegegestaltung des im Masterplan Emscher-Zukunft vorgesehenen Emscherwegs.
Zeit und Umfang
Das Projekt begleitet den Umbau der Emscher und ist in drei Phasen eingeteilt.
Phase I reicht bis zum Jahr 2010. Hier sollen im Rahmen der Aktivitäten „Kulturhauptstadt 2010“ drei „Stationen“ des Emscher-Pfads der Kulturen realisiert werden. Diese sind als Bestandteil des Projekts „emscher:reloaded“ konzipiert, das neben der Entwicklung des Emscher-Pfads der Kulturen auch den „Emscher-Salon“ und das Festival „open systems“ realisiert. Zudem wird in Erwägung gezogen, die erste Phase mit einer internationalen Konferenz zum Thema „Emscher-Kultur im Wandel“ im Rahmen der „Kulturhauptstadt 2010“ abzuschließen.
Phase II umfasst den Zeitraum 2011 bis 2015, knüpft an die in der ersten Phase gesammelten Erfahrungen an und dient der Realisierung von zwei weiteren „Stationen“ sowie der Weiterentwicklung des Konzepts.
Phase III reichend bis zum Jahr 2020 dient der Planung und Gestaltung von zwei weiteren „Stationen“ und der Organisation und Durchführung einer Abschlussveranstaltung.
Die folgenden konzeptuellen Überlegungen sind zunächst auf die Ausgestaltung der ersten Schritte von Phase I gerichtet. Eine Weiterentwicklung des Konzepts Phase II und Phase III betreffend erfolgt am Ende von Phase I.
Orte und Flächen
An drei ausgewählten Orten entlang der Emscher werden zunächst drei „Stationen“ des Emscher-Pfads der Kulturen realisiert. Die Orte liegen nicht allzu weit voneinander entfernt, so dass die Idee eines „Pfads“ und seiner „Stationen“ mit dem Fahrrad und ggf. auch zu Fuß und mit ÖPNV erfahrbar wird. Die Auswahl der Orte folgt dem Prinzip der Heterogenität. Die Größe, der Grad der sozialräumlichen Anbindung wie auch die Vernetzung mit anderen kulturellen und sozialen Aktivitäten variieren.
So sollen sowohl kleine Flächen mit ca. 1.000 qm als auch Fußballfeld große Flächen (ca 3.500 qm) und auch größere Areale als „Station“ gestaltet werden.
Die Flächen schließen zum einen an bereits existierende Parks und Gärten an und ermöglichen hier eine Erweiterung und Diversifizierung bestehender Aktivitäten. Zum anderen werden auch neue Areale erschlossen und gestaltet.
Um die Kosten des Projekts in Grenzen zu halten, wird auf Flächen zurückgegriffen, die entweder im Besitz der Emschergenossenschaft sind oder den Kommunen gehören.
Themen und Inhalte
Gärten und Parks spiegeln die Wünsche, Anliegen und Ideale ihrer Zeit; dies gilt für den englischen Landschaftsgarten genauso wie für den Kleingarten oder ein kommerziell betriebenes Disneyland. Der ideelle Bezugspunkt von Gärten ist das Paradies und so gestaltet die Gartenkunst auch immer Orte irdischen Vergnügens, und jeder Garten transportiert das Versprechen eines glücklichen Lebens abseits von Arbeit und Alltag.
Jede „Station“ entlang des Emscher-Pfads der Kulturen will in der Form eines Gartens Wünsche und Anliegen der benachbarten Bevölkerung wie auch gartenkulturelle Traditionen realisieren. Die Ausgestaltung soll dabei an vier übergreifenden Inhalten angelehnt sein:
Zum einen werden mit künstlerischen und kulturellen Mitteln verschiedene Wünsche, Anliegen und Erwartungen an den Emscher-Raum zum Thema gemacht. Da diese Wünsche und Freizeitanliegen jedoch mit den beteiligten Bevölkerungsgruppen (Junge/Alte, Männer/Frauen, Arbeitslose/Berufstätige) variieren, soll zum zweiten die sozialkulturelle Vielfalt bei der Ausgestaltung der Stationen-Gärten thematisiert werden. Drittens ist die sozialkulturelle Vielfalt der Bevölkerung in der Emscherregion durch ihre Geschichte als ehemalige Einwanderungsregion, also durch Migration, gekennzeichnet. Da aber die ehemalige Einwan�derungsregion Emschertal heute von Abwanderung und Strukturwandel gekennzeichnet ist, soll viertens schließlich die Rolle und Bedeutung von Zeit – lebensgeschichtlich, historisch und als allgemeiner ‚Lauf der Dinge’ – dargestellt werden.
Die thematische Ausgestaltung ist aufgrund der spezifischen Örtlichkeit und Inhaltlichkeit des Emscher-Pfads der Kulturen zentriert um das Thema „Wasser“.
Die Gestaltung der Gärten entwickelt sich innerhalb der Matrix:
Die Matrix und der thematische Schwerpunkt bilden den Rahmen der Ausgestaltung einer jeden „Station“ und ihres Gartens, so dass ein konzeptioneller roter Faden sichtbar wird und eine Bezugnahme und Einordnung in das Gesamtkonzept möglich ist. In der konkreten Ausgestaltung jedoch – der Füllung des Rahmens – variieren die Gärten im Hinblick auf ihre Größe und damit verbunden die räumlichen Möglichkeiten der Gestaltung, hinsichtlich der beteiligten Bevölkerungsgruppen und der Breite und Vielfalt der thematischen Akzentuierungen und Ausgestaltungen. Auch das Ausmaß und die Formen von Partizipation sind unterschiedlich.
Partizipation und Mitarbeit
Die Beteiligung und Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein politisches Anliegen. Es geht um mehr als um Techniken kurzfristiger Mobilisierung oder die Verhinderung von Reibungsverlusten bei der Regionalplanung. Bei partizipativen Planungsprozessen geht es auch immer um Fragen von Zugehörigkeit, Engagement und Identifizierung, um Raumnutzung und Raumaneignung, um die Wünsche von Vielen und die Vielfalt der Wünsche und deren Realisierungsmöglichkeiten.
Die „Stationen“ entlang des Emscher-Pfads der Kulturen sollen von der lokalen Bevölkerung genutzt und angenommen werden. Deshalb müssen die Menschen vor Ort auch an der Planung und Ausgestaltung beteiligt sein. Im Rahmen der ersten drei „Stationen“ soll mit unterschiedlichen Formen der Partizipation und verschiedenen Ausmaßen von Mitgestaltung der lokalen Bevölkerung gearbeitet werden.
So soll an einer „Station“ ergebnisoffen gearbeitet werden, d.h. die Wünsche und Gestaltungsanliegen der lokalen Bevölkerung stehen im Vordergrund und die Partizipation der Anwohnerinnen und Anwohner steht im Mittelpunkt.
An einer zweiten „Station“ machen Experten eine kulturelle Vorgabe und das zu realisierende Ergebnis wird in Abstimmung mit ausgewählten lokalen Nutzergruppen geplant und durchgeführt.
An der dritten „Station“ realisiert sich die Ausgestaltung des geplanten Gartens im Spannungsverhältnis von Kunst, Politik und Sozialarbeit. Hier soll mit anderen Trägern, Gewerbetreibenden, Netzwerken und Institutionen kooperiert und neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit erprobt werden.
Experten und Unterstützer
Die konkrete Gestaltung und Realisierung des geplanten Gartens wird mit Unterstützung und/oder Anleitung von Experten durchgeführt. Die Experten geben auch im Vorfeld der Planung entsprechende Informationen und Inputs, denkbar sind beispielsweise Exkursionen zu verschiedenen Parks im Umland, Dia-Shows zum Thema japanische, indische, chinesische, türkische, italienische und französische Parks und Gärten, Informationsabende, an denen verschiedene Experten ihre Vorstellung von Raum und Landschaft thematisieren, an denen z.B. Architekten, Skateboarder, Radler und Hundebesitzer zu Wort kommen. Auch Menschen, die Spaß und Erfahrung an und mit der Gartenarbeit haben, sollen angesprochen und für die Teilnahme am Projekt gewonnen werden.
Auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, als Moderatoren der Partizipationsaktivitäten wie auch bei der Werbung für den Emscher-Pfad der Kulturen und für das Mitmachen an dem Projekt sollen Experten beteiligt sein. Zudem gilt es, Kooperationspartner aus verschiedenen Bereichen von Politik, Wirtschaft und sozialen und kommunikativen Einrichtungen zu finden.
Konkretisierungen und Konzeptualisierungen
Zur Konkretisierung und Ausgestaltung der im Punkt „Themen und Inhalte“ erwähnten Matrix ist die Orientierung an den folgenden strukturierenden Fragen oder Leitlinien denkbar:
Eckpunkt „Migration“
- Geschichte der Einwanderung in der konkreten Region
- Wege in die Zukunft
- Ankommen/Weggehen: Stationen des Weges
- Zuhause/Heimat/Fremde
- Grenzen/Begrenzungen/Überschreiten von Grenzen
Eckpunkt „Zeit“
- Lebenszeit/Arbeitszeit/Freizeit
- Zeitläufte, historische Epochen
- Wandel von Landschaft im Verlauf der Zeit
- Zeitpunkte/Momentaufnahmen
- Ursprung, Tradition, Wandel von Gartenkulturen
Eckpunkt „Raum/Ordnung/Nutzung“
- Gestaltung des Ortes
- Offenheit/Geschlossenheit/Grenzziehungen
- Sauberkeit
- Pflanzen/Ornamente/Tiere
Eckpunkt „Kulturelle Vielfalt“
- Kulturspezifische Elemente der Gartenkunst und Gartenkultur
- Verschiedene Ansprüche von Nutzergruppen (z.B. Jugendliche, Familien, Männer)
- Kulturkontakt/Kulturkonflikt
- Rolle und Bedeutung von Sprache(n)
Ideensammlung
Für die thematische Leitlinie „Wasser“ wäre denkbar, dass Installationen, Objekte, Brunnen, Bäche angelegt werden und die Beteiligten ihre Vorstellungen von Wasser und Umwelt thematisieren, beispielsweise indem sie ihr unterschiedliches ökologisches Bewusstsein zum Ausdruck bringen, Stelltafeln zur Geschichte des lokalen Raums erarbeiten oder Nutzungsansprüche des Gartens dokumentieren.
Bereits existierende, besondere und interessante Privat-Gärten könnten in das Konzept integriert werden und beispielsweise über Internet-Suche oder Preisausschreiben zum Thema „Wer hat den schönsten Garten?“ ausgewählt werden und dann als „Station“ oder „Zwischenstation“ entlang des Emscher-Pfads der Kulturen auch besichtigt werden. Als thematische Ausgestaltung der Matrix könnte die Realisierung eines W-LAN-Gartens in Erwägung gezogen werden. Hier werden Raum und Zeit aufgehoben, spielen Migration, Herkunft eine zunehmend geringere Rolle und ist die kulturelle Vielfalt ein Markenzeichen. Auf kleinem Raum wäre ein Treffpunkt für Internet-Nutzer, Interessierte und Lernwillige gegeben.
Anmerkungen
(1) Siehe dazu den Überblick bei: Meier-Braun, K.: Deutschland, Einwanderungsland. Frankfurt/M. 2002 oder auch: Bade, K./Bommes, M./Münz, R.: Migrationsreport 2004. Frankfurt/M. 2004.
(2) Eine 2005 erschienene im Auftrag des Kommunalverbands Ruhr von der Universität Essen-Duisburg erstellte Studie hat sichtbar gemacht, dass im Besonderen Mieter die Emscher-Region verlassen. Offenbar wirkt Wohnungseigentum der Abwanderung entgegen. Darüber hinaus wurde festgestellt: „Bislang gingen viele davon aus, die Suche nach günstigem Eigentum treibe Familien ins Umland. Dieser These widerspricht die Studie auch in anderer Hinsicht: Die meisten Leute ziehen von einer Ruhrgebietsstadt in eine andere. Und: Die meisten Umzieher sind kinderlos.
(3) Zwar bevorzugen Familien mit Kindern und ältere Ehepaare Städte am Ballungsrand, eine wirkliche Umlandwanderung gab es aber nur in Duisburg und Dortmund. Stadtteile in der Emscherzone wie die Dortmunder Nordstadt verlieren auch Einwohner, weil die Mieter mit der Umwelt und der sozialen Situation im Stadtteil unzufrieden sind.“ Vgl. www.mieterforum-ruhr.de/de/themen/stadt/index.php/art_00000206
(4) Vgl. z.B. Motte, J./Ohliger, R. (Hg.): Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft. Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik. Essen 2004.
(5) Peripherie ist überall. Hg. von Walter Prigge, Frankfurt/M. 1998.
(6) Mit der Entwicklungsvorstellung von nachhaltiger Entwicklung soll die entsprechende Politik so gestaltet werden, dass die Chancen künftiger Generationen nicht beeinträchtigt werden. Unter dem Motto „Global denken - lokal handeln“ wird jede Kommune der Unterzeichnerländer aufgerufen, eine „lokale“ Agenda 21 zu erarbeiten.
(7) Kurt, H.: Agenda 21 - Eine Herausforderung an Neue Kunst im öffentlichen Raum? In: Stadt und Natur. Kunst und Ökologie. Hg. von Detlev Ipsen u. Astrid Wehrle, Frankfurt/M. 1998, S. 109-116.
(8) Barck, K./Gente, P./Paris, H./ Richter, S. (Hg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig 1990.
(9) Büttner, C.: Art Goes Public. Von der Gruppenausstellung im Freien zum Projekt im nicht-institutionellen Raum. München 1997. Zur Veranschaulichung seien hier die Projekte der Gruppe um den Hamburger Künstler Christoph Schäfer („Park Fiction“), der Wiener Gruppe WochenKlausur und der Chicagoer Gruppe Haha genannt. Auch die interaktive Installation Les Mots de Paris von Jochen Gerz ließe sich anführen: Hier war im Jahr 2000 auf dem Vorplatz der Notre-Dame Kirche in Paris eine Vertiefung in den Boden eingelassen, mit dicker Glasplatte und Schlitz zum Geldeinwerfen. Als Fließtext in die Glasplatte eingraviert waren Wörter, Gedichte, Sätze der Clochards, Sätze wie: „Wenn man kein Haus hat, muss man sich ein Universum schaffen“, oder „Die Straße hat kein Gesicht. Sie macht keinen Sinn. Sie überfällt Euch. Die Straße, das bist Du, auch wenn Du nicht auf der Straße bist.“ Am meisten Aufsehen erregten jedoch die gesprochenen Wörter der Clochards selbst, die im touristischen Zentrum von Paris, von wo sie ansonsten vertrieben werden, im Rahmen des Kunstprojektes mit den Passanten über ihre Situation ins Gespräch treten konnten. Dies stellte für die etablierte Kunstwelt, welche die Aktion nicht als Kunst, sondern als „Sozialarbeit“ verstand, eine Provokation dar. Die Einnahmen (gut 100.000 Francs) auf ein Konto der Obdachlosenvereinigung bildeten den Grundstock für ein neues nicht karitatives Arbeitsprojekt mit Obdachlosen.
(10) Demirovic, A.: Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit, Demokratie. In: Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften, 33. Jg., H. 185, 1991, S. 41-55. Oder auch: Beck, U.: Die offene Stadt – ‚Architektur in der reflexiven Moderne’. In: ders.: Die feindlose Demokratie. Stuttgart 1995, S. 121-130.
(11) Siehe z.B.: Helbrecht, I.: Das Ende der Gestaltbarkeit? Zu Funktionswandel und Zukunftsperspektiven räumlicher Planung. Oldenburg 1991 oder auch: Selle, K.: Was ist nur mit der Planung los? Erkundungen auf dem Weg zum kooperativen Handeln. Dortmund 21996.
Vgl. Deleuze, G/Guattari, F.: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie. Frankfurt/M. 1977.
(12) Siehe dazu auch das vom European Garden Heritage Network geförderte Projekt „Gartenkunst im Ruhrgebiet“, www.wege-zur-gartenkunst.de
>> Seitenanfang

|
|
|
